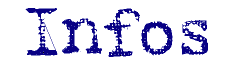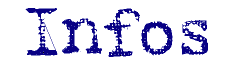Warenkunde
Honig
(Schrot und Korn 4/96)
zurück zur Übersicht
|
Mehr als ein kleiner Unterschied
Honig aus ökologischer Imkerei
Wie in kaum einem anderen landwirtschaftlichen Nutztierbereich genießt
die Bienenhaltung ein Grund-Vertrauen der KäuferInnen, das sich auf
eine natürliche und ökologische Erzeugung und Verarbeitung des
Honigs stützt. Aber auch in der Imkerei gibt es Probleme mit den Folgen
von Massentierhaltung wie Bienenkrankheiten, medikamentöse Behandlung
und Rückstände im Produkt - Argumente für ökologische Imkerei.
Die aus dem indischen Raum nach Deutschland eingeschleppte Varroamilbe löste
Ende der siebziger Jahre in Deutschland ein großes Bienensterben aus.
Unter den Imkern herrschte Ratlosigkeit. Die eingesetzten chemotherapeutischen
Medikamente sollten das Überleben der Völker sichern, allerdings
wurden Rückstände der Gifte auch im Honig gefunden. In dieser
Situation suchten einige Imker nach Alternativen bei der Behandlung der
erkranken Völker und kamen über diesen schwierigen Prozeß
schließlich zu einem neuen Ansatz in der Bienenhaltung - der
ökologischen Imkerei. Die in der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer
Landbau (AGÖL) aktiven Verbände erkannten bald den Handlungsbedarf
und nahmen sich der Problematik an. Richtlinien zur ökologischen Bienenhaltung
gibt es von Demeter, Bioland und Naturland.
Die Anbauverbände haben für ihre Mitglieder Richtlinien für
die ökologische Bienenhaltung erarbeitet. Dabei sind die Kernpunkte
der Statuten identisch. Demeter legt zusätzlich Wert auf eine besonders
ursprüngliche Bienenhaltung.
Die zentralen Forderungen stimmen jedoch überein. Die wichtigsten sind:
- Keine chemotherapeutischen Medikamente
Die konventionelle Imkerei erlaubt die Behandlung mit chemotherapeutischen
Medikamenten wie zum Beispiel Apistan. Apistan gehört zu den Pyrethroiden
(chemische Nachbildungen des natürlichen Pyrethrums). Die ökologische
Imkerei verbietet die Behandlung der Bienen mit diesen Medikamenten. Erlaubt
sind biotechnische Methoden und einfache Säuren wie Milch- oder Ameisensäure.
- Bienenwohnung aus natürlichen Materialien
Die Beute - so heißt die Bienenwohnung in der Fachsprache -
darf nur aus Holz, Stroh oder Lehm bestehen.
Erlaubt sind schadstofffreie Anstriche wie Naturfarben auf Leinölbasis.
- Wachserzeugung und Naturwabenbau
Die ausschließliche Verwendung von Bioland-, Demeter- oder Naturland-Wachs
und der Naturwabenbau sind wesentliche Forderungen der Öko-Imker. In
der konventionellen Bienenhaltung ist es üblich, die Altwaben einzuschmelzen
und bei einem Wachsverarbeiter gegen neu gepreßte Mittelwände
einzutauschen. So kann es passieren, daß der Imker Medikamentenrückstände
in seine Beute einträgt, selbst wenn er keine benutzt. Wachs ist ein
idealer Schadstoffträger, da sich die chemischen Stoffe in dem fetthaltigen
Material besonders gut anreichern. Noch schlimmer ist es, wenn der Imker
chemotherapeutische Medikamente benutzt und seinen eigenen geschlossenen
Wachskreislauf betreibt, das heißt das eigene Wachs wieder und wieder
einschmilzt.
Deshalb schreiben die Verbände des kontrolliert biologischen Anbaus
verstärkt den Naturwabenbau vor. Dabei wird nur ein Anfangsstreifen
aus Wachs vorgegeben, der die Richtung des Wabenbaus lenkt. Das nun von
den Bienen frisch erzeugte Wachs darf nach der Nutzung einmal eingeschmolzen
und zur Mittelwandherstellung genutzt werden.
- Wabenhygiene
Zur Bekämpfung der Wachsmotte sind nur thermische Verfahren sowie Essigsäure
zugelassen. Andere Mittel, wie zum Beispiel Paradichlorbenzol, das konventionell
angewendet werden darf, können sich im Wachs anreichern.
- Honigernte
Verbot von chemischen Repellents bei der Honigernte. Um die Bienen bei der
Ernte von den Honigwaben fernzuhalten, dürfen nur mechanische Methoden
angewendet werden.
- Honigverarbeitung und Qualitätssicherung
Die Anbauverbände schreiben eine schonende Erwärmung des Honigs
und eine schonende Lagerung vor. Es dürfen nur Arbeitsgeräte aus
lebensmittelechtem Material verwendet werden. Regelmäßige Qualitätskontrollen
sind Pflicht.
Kein Bio-Standard
nach EU-Recht
Anders als im Bereich pflanzlich erzeugter Lebensmittel gibt es für
Produkte aus tierischer Erzeugung bisher noch keine EWG-Richtlinien. Sie
sollen noch im Laufe dieses Jahres erstellt werden. Solange sind die Bezeichnung
"Bio oder Öko" noch nicht geschützt und kein einheitlicher
Standard geschaffen. Wird dieser allerdings nach dem jetzigen Kurs der EU-Politiker
beschlossen, wäre eine Honig-Zertifizierung in Europa kaum mehr möglich.
Denn Brüssel setzt bei der Bio-Zertifizierung am Maßstab Fläche
an. So sollen die Bienen nach dem Willen der Bürokraten für Bio-Honig
nur in solchen Gebieten ihren Nektar und die Pollen sammeln, in denen keine
konventionelle Landwirtschaft und keine Spritzmittel angewendet werden.
Das ist in Europa nicht durchführbar. Bienen haben einen Sammelradius
von bis zu fünf Kilometer und unterscheiden nicht zwischen ökologisch
und konventionell angebauten sowie wildwachsenden Pflanzen. Völlig
unberücksichtigt bliebe bei dieser Regelung die Wirtschaftsweise des
Imkers.
Bio-Honig aus dem Ausland
Solange es noch keine einheitliche Regelung gibt, ist es auf dem Honig-Markt
zur Zeit noch etwas unübersichtlich. So bindet zum Beispiel der Imkerhof
Allos in Mariendrebber, der Naturkostläden mit Honig aus aller Welt
beliefert, seine ausländischen Bio-Honig-Lieferanten, in Absprache
mit den EU-Kontrollstellen, an den Richtlinienkatalog der IFOAM (International
Federation of Organic Agricultural Movements). Die IFOAM, die Basis-Standards
für ökologischen Landbau und Lebensmittelverarbeitung international
erarbeitet, hat mit ihrem Richtlinienentwurf ein Papier vorgelegt, das Mindestanforderungen
an Honig aus ökologischer Imkerei vorgibt. Der Entwurf soll im August
auf der Generalversammlung der IFOAM in Kopenhagen verabschiedet werden.
Die Basis-Standards enthalten einige wesentliche Forderungen, die auch die
deutschen Anbauverbände aufstellen. Allerdings verlangt auch die IFOAM
ein Nektar-Sammelgebiet, das zu 90 Prozent aus ökologisch bewirtschafteter
Landwirtschaft oder wilder Vegetation besteht. Nicht berücksichtigt
wird die Wachsproblematik.
Allos vermarktet rund 400.000 Kilo Bio-Honig im Jahr. Die Sorten kommen
aus Mexiko (Zertifizierung durch OCIA), Kanada (OGBA), Neuseeland (Bio-GRO)
und Uruguay. Regelmäßige Laborkontrollen der Honige sollen die
hohe Produktqualität absichern. Die 40.000 Kilo Honig aus Deutschland
im Allos-Sortiment kommen noch aus konventioneller Imkerei.
Halbe Sachen aus Frankreich?
Für den Naturkostkunden schwierig zu beurteilen ist die Situation bei
französischem Honig. Die anerkannte Anbauorganisation Nature et Progres
war 1983 der erste Verband, der Richtlinien für eine ökologische
Bienenhaltung vorlegte, und auf ihnen basieren auch heute noch viele imkerliche
Richtlinien in anderen Ländern. Doch die großen Berufsimker,
von denen es in Frankreich wesenlich mehr gibt als bei uns, haben nach wie
vor massive Probleme mit der Varroamilbe und werden mit den erlaubten Mitteln
wie Milch- und Ameisensäure nicht immer Herr über den Befall.
Nature & Progres toleriert deshalb unter Angabe der Zusatzdeklaration
"Orgamiel" die Anwendung von Pyrethroiden. "Orgamiel"-Honig
ist also kein Bio-Honig. Dem Naturkostkunden bleiben solche Feinheiten allerdings
verborgen. Kein Hinweis auf dem Glas verrät etwas über diese praxis.
Und so wissen nur Insider über die Bedeutung der Zusatzdeklarierung.
Auch Biofranc, eine Honigmarke, die ebenfalls im Naturkostladen zu finden
ist, erlaubt die Anwendung von Pyrethroiden. Diese Tatsache ärgert
besonders die heimischen Öko-Imker, die den Verbraucher damit getäuscht
sehen.
Allos, der französischen Honig im Sortiment führt, weist ihn korrekterweise
nicht als Bio-Honig aus. Das Unternehmen kontrolliert diese Chargen besonders
auf Medikamentenrückstände zur Sicherung des Qualitätsstandards.
Versuche des Honigimporteurs, die französischen Imker zu einer anderen
Haltung in punkto chemische Therapeutika zu bewegen, waren bisher erfolglos.
Der Biene kommt in der Natur eine wichtige Aufgabe zu. Sie ist ein wichtiges
bestäubendes Insekt und ohne sie könnte die Vielfalt unserer Vegetation
nicht erhalten werden. Deshalb ist es sinnvoll, die ökologische Imkerei
an fast jedem Standort zu betreiben. Eine Begrenzung auf bestimmte Gebiete,
wie es die EU-Kommission plant, würde dem ökologischen Grundgedanken
einer flächendeckenden Bienenhaltung widersprechen. Diese Regelung
ließe nur Importhonig zur Zertifizierung zu.
Die Zertifizierung "Bio-Honig" ist jedoch nicht nur eine Qualitätsaussage
im Sinne einer objektiv beurteilbaren Honig-Qualität, sondern eine
soziale Anerkennung des Imkers, der die Bienenhaltung nach den Richtlinien
seines ökologischen Anbauverbandes ausrichtet. In Naturkostläden
ist Honig aus regionaler Öko-Imkerei bisher noch nicht überall
und immer zu finden. Das liegt zum einen am reichhaltigen internationalen
Angebot. Zum anderen muß das Bewußtsein für den Sinn der
ökologischen Betriebsweise bei den NaturkostkundInnen noch wachsen.
Astrid Wahrenberg
|